Was haben Commodore, Maybach und AEG gemeinsam? Sie waren mal sehr erfolgreich, doch irgendwann gingen sie unter. Die Gründe für Firmenpleiten sind vielfältig. Ein wichtiger kann sein, dass sich Unternehmen nicht schnell genug an den Wandel der Zeit anpassen. Selbst traditionsreiche Marken kommen deswegen ins Straucheln, Yahoo und Blackberry sind zwei aktuelle Beispiele. Viele Firmen können nur überleben, wenn sie dem Wandel folgen und einen radikalen Kurswechsel einleiten: ein Reboot muss her. Wir zeigen anhand von mehreren Beispielen, wie sich bekannte Weltkonzerne und Startups gleichermaßen durch einen solchen Business Pivot retten konnten und damit einen gelungenen Neustart hinlegten.

Inhaltsverzeichnis
Aber was ist eigentlich ein „Business Pivot“?
Was heutzutage bisweilen als „Pivot“ beschrieben wird, ist vereinfacht gesagt die Kursänderung eines Unternehmens: eine neue, oft radikal andersartige Strategie, die notwendig ist, um die eigenen Visionen umzusetzen und dabei die Firma am Leben zu erhalten. Anders ausgedrückt: Man muss einen neue Ausrichtung einschlagen, ansonsten droht die Insolvenz oder der Bankrott.
Es gibt verschiedene Wege, um den Business Pivot zu zu vollziehen. Entweder reduziert man radikal sein Produkt und fokussiert sich auf ein einziges Feature. Oder man richtet sein Produkt auf eine komplett neue Zielgruppe aus. Oder man behält die Zielgruppe im Blick, ändert aber das Produkt. Auch eine Änderung eines Preismodells kann als Pivot dienen.
Schauen wir uns das doch einmal anhand einiger Beispiele an.
Nokia: Von der Papierfabrik zum Handy-Hersteller
Sie hießen 3110, 3210, 6110 oder N70. Sexy klingen diese Modellbezeichnungen nicht, trotzdem waren sie in den 1990er- und 2000er-Jahren bei Handynutzern bestens bekannt. Denn die fast schon kryptischen Namen stammten von Nokia. Die finnische Firma war mal Marktführer für Mobiltelefone, auch heute noch assoziiert man das mittlerweile in Häppchen zerlegte Unternehmen mit Mobiltelefonen. Was viele gar nicht wissen: Nokia gibt es nicht erst seit dem ersten Handyboom. Das Unternehmen kann auf eine über eine 150-jährige Geschichte zurückblicken, das Auf und Ab der Handysparte ist davon nur ein kurzer Ausschnitt.
Unter der Flagge des traditionsreichen Markennamens wurde sogar mehrmals die Ausrichtung gewechselt, Nokia folgte Trends oder erschuf sie. Dabei setzen die Finnen nicht auf eine horizontale oder vertikale Erweiterung des Portfolios. Nein, man schlug auch gerne einmal komplett neue Wege ein. „Pivot“ hat man das damals vielleicht noch nicht genannt. Aber genau darum handelt es sich.
Alles begann 1865. Damals gründete Fredric Idestam eine Papierfabrik. Doch dabei blieb es nicht: Man expandierte in verschiedene Richtungen. Nokia fusionierte in seiner bewegten Vergangenheit mit einer Gummifabrik und mit einem Kabel-Unternehmen. Erst in den 1980ern wurde aus Nokia schließlich das, was man heute kennt: ein Hersteller von Mobiltelefonen. Zudem etablierte man sich unter anderem als Anbieter für Netzwerk- und Unterhaltungstechnik und entwickelte Navigationssoftware.

Bis in die Anfangsjahre der 2000er lief alles bestens. Im Jahr 2007 konnte Nokia einen Gewinn von 7,2 Milliarden US-Dollar ausweisen. Doch dann wagten mehreren Konkurrenten den Angriff. Einer davon stammt aus dem US-amerikanischen Cupertino: Apple.
Die Firma von Steve Jobs präsentierte in diesem Jahr das iPhone. Das war nicht irgendein Handy, sondern ein Smartphone. Die Geräteklasse gab es im Prinzip schon zuvor, unter anderem wurde sie von Nokia mit dem Nokia Communicator bedient. Doch das Konzept von Apple schmiss viele bis dahin bekannte Konventionen (z.B. die Tastatur) über Bord und trumpfte mit wegweisenden Innovationen auf.
Das vorläufige Ende der Geschichte ist bekannt: Der Hype rund um das iPhone beschert Apple rosige Geschäftszahlen. Rund 11 Milliarden Dollar Gewinn machte man 2015 damit – und das allein im vierten Quartal und nur mit dem iPhone, wohlgemerkt. Zahlen, die Nokia nie erreichte, und auf die man heute wohl mehr als neidisch blickt. Zumal Nokia seine Bedeutung als Handy-Hersteller verlor: Die Sparte wurde 2011 an Microsoft verkauft und als Label für Smartphones mit dem erfolglosen Windows-Betriebssystem verwendet. Mittlerweile hat auch Microsoft den einst so klangvollen Markennamen von seinen Mobiltelefonen gestrichen, Produktionsstandorte geschlossen und den Geschäftsbereich teilweise an Foxconn verkauft.
Aus dem Marktführer Nokia wurde mittlerweile so etwas wie ein gealterter Popstar: Man denkt gerne an die glorreichen Zeiten zurück, doch der Dinosaurier passt nicht mehr in die moderne Zeit und wird wie saures Bier weitergereicht. Vielleicht schafft die immer noch bekannte Handy-Marke dank eines ausgeklügelten Strategiewechsels ein erneutes Comeback? Vielleicht als Marke für Feature Phones im Low-Budget-Segment? Das wäre ein möglicher Weg, zumindest kurzfristig gedacht.
Trotz aller Pleiten und Verkäufe: Wie es scheint, geben die Finnen erneut nicht auf, sondern arbeiten an ihrer Transformation. So übernahm man dieses Jahr den Anbieter Withings, um mit Fitnesstrackern, smarten Thermometern und WLAN-Wagen im Markt für „Digital Health“ neu durchzustarten. Nicht aufgeben, Altes abstreifen und Neues probieren: Es scheint, als würde Nokia aus den Stärken und Erkenntnissen der Vergangenheit schöpfen, um – mal wieder – durchzustarten. Ob dieser Reboot erneut erfolgreich sein wird, zeigt der zukünftige Lauf der Geschichte.
Gefällt dir dieser Artikel?
Dann trage dich jetzt ein ins „Update am Montag“ und bleibe über neue Inhalte auf dem Laufenden. Kein Spam! Bereits knapp 2.000 Leser:innen sind dabei.
Steve Jobs war Apple und Apple war Steve Jobs
Nur nicht aufgeben, egal, wie hart der Gegenwind ist – das war auch das Credo des schon erwähnten Steve Jobs. Er wurde aus seinem eigenen Unternehmen, Apple, vergrault, musste später unter anderem bei Pixar und Next massenhaft Mitarbeiter entlassen und am Ende erlag er einem Krebsleiden. Doch zwischen den Niederlagen erlebte Steve Jobs auch wunderbare Hoch-Zeiten.
Jobs wurde von der Süddeutschen Zeitung als das „Stehauf-Apfelmännchen“ bezeichnet. Das mag seltsam klingen und ist eigentlich nur eine gut klingende Schlagzeile als Umschreibung für Phoenix. Oder Ikarus. Oder Midas. Die Vergleiche mit historischen Figuren soll stets das Gleiche sagen: Dieser Mann wollte stets das Höchste und Beste erreichen, dafür wagte er viel und gab niemals auf.
Diese Mentalität mündete in vielen Zitaten, die heute in der Start-up-Szene gerne wiedergegeben werden. Sätze wie: „Ich glaube, wenn du etwas machst und es läuft gut, dann solltest du etwas anderes Wunderbares machen, bleib nicht zu lange bei einem. Denk daran, was als nächstes dran ist“, oder: „Deine Arbeit wird einen großen Teil deines Lebens einnehmen und die einzige Möglichkeit, wirklich zufrieden zu sein ist, dass du glaubst, dass du großartige Arbeit leistest“, treiben Entrepreneure an, um in den schweren Zeiten des Unternehmerdaseins durchzuhalten.
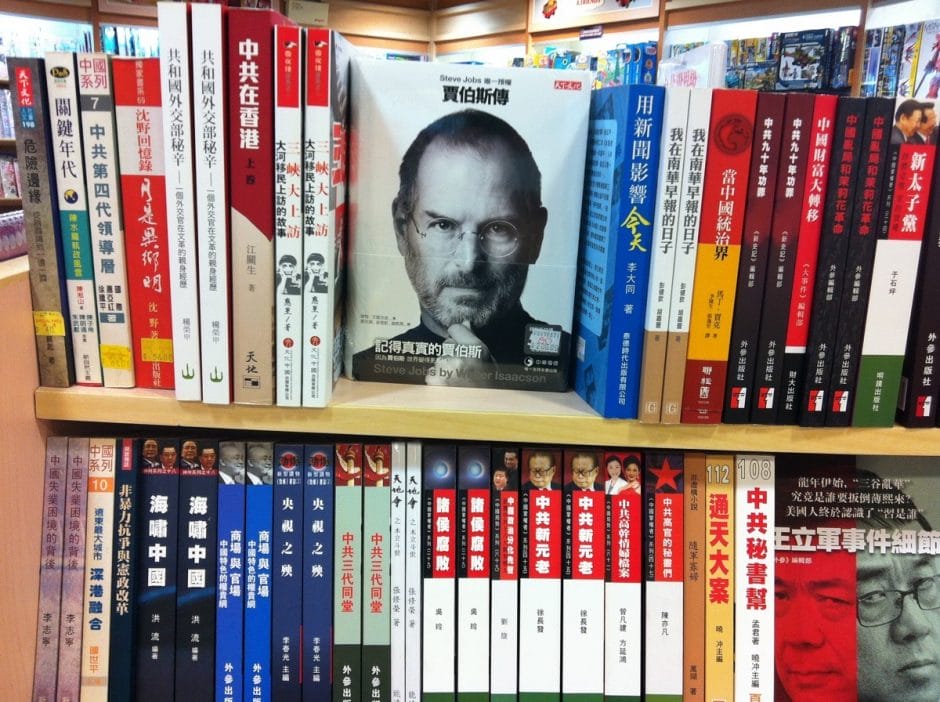
Schöne Zitate von erfolgreichen Gründern gibt es viele. Eines davon ist weniger verblümt: „Gründen ist ein arschharter Trip“, sagte mal der deutsche Seriengründer Frank Thelen in einem Interview. Was er damit meinte, kann man auch anders ausdrücken: Wer sein Gründer-Gen auslebt, der muss viele Tiefschläge hinnehmen und mehrmals gegen die Wand fahren, bis er erfolgreich ist. Und erfolgreich zu sein heißt nicht, dass man den Erfolg auf ewig gepachtet hat. All das beweist das Leben von Steve Jobs eindrücklich.
Obwohl er heute als glitzernde Ikone dargestellt wird, die vermeintlich alles richtig gemacht hat, so gab es auch im Leben von Jobs einige Flops. Daraus lernte er und wagte immer und immer wieder einen Neustart. Pixar beispielsweise sollte erst ein Hersteller von Hochleistungs-Grafikcomputern sein, bevor es zu einem der einflussreichsten Filmstudios der Welt wurde. Und das ziellose und beinahe bankrotte Apple stutzte er nach seiner Rückkehr zunächst auf einige wenige Geräte zurück und legte dann mit iPod, iPhone und anderen Produkten die Grundlagen für den heutigen Erfolg. Ende der 90er waren Macs ein Nischenprodukt für sehr spezielle Märkte wie beispielsweise Desktop Publishing. Heute ist Apple eine Consumer-Marke, deren Produkten man kaum entgehen kann. Für diesen radikalen Wandel stützte sich Steve Jobs übrigens auf viele Mitarbeiter, Manager und Produkte, die er aus seiner zweiten Computerfirma Next mitgebracht hatte. Die war weitgehend erfolglos geblieben. Ohne diesen Hintergrund hätte aber vielleicht auch ein Steve Jobs den Pivot von Apple nicht hinbekommen.
Nintendo: Unterschätzt niemals die Japaner!
1889 produzierte Fusajiro Yamauchi in Kyoto Blumen-Spielkarten, die sogenannten Hanafuda. Die Firma dahinter bekam einen Namen, der übersetzt so viel wie „Lege das Glück in die Hände des Himmels“ bedeutet. Das schrieb Yamauchi mit drei japanischen Schriftzeichen nieder: Nin für Pflicht und Verantwortung, Ten für Himmel und Do für Tempel oder Halle. Zusammengeschrieben ergab sich daraus: Nintendo.
Das Geschäft mit den Hanafuda-Spielkarten lief über viele Jahrzehnte hinweg gut. Doch in den 1950er-Jahren gingen die Umsätze zurück und es mussten neue Geschäftszweige gefunden werden. Diese lagen aber nicht im Entertainment-Bereich. Stattdessen orientierte sich Nintendo in unterschiedliche Branchen, wozu unter anderem ein Taxi-Unternehmen und die Produktion von Instant-Reis gehörten.
Das alles brachte nicht den erhofften Erfolg. Also konzentrierte man sich wieder aufs Kerngeschäft. So gelang Nintendo als erstes japanisches Unternehmen die Massenproduktion von Plastikspielkarten, zudem schloss man einen Deal mit Disney, um Spielkarten für Kinder zu veröffentlichen.
Mit der voranschreitenden Technisierung gab es neue Möglichkeiten, welche auch für Unterhaltungsprodukte galt: In den 1970er-Jahren wandte sich Nintendo dem neu entstandenen und boomenden Markt für Videospiele zu. Das japanische Unternehmen brachte zuerst im heimischen Markt erfolgreich mehrere Spielkonsolen heraus, danach folgte die Expansion in die USA und nach Kanada.

Im folgenden Jahrzehnt erschienen die Plattformen, die auch heute noch weltweit bekannt sind. 1983 veröffentlichte Nintendo den Famicom (eine Abkürzung für Family Computer), der in Europa als NES (Nintendo Entertainment System) auf den Markt kam. 1989 stellte Nintendo mit dem GameBoy ein weiteres System vor, das ebenfalls bei Jung und Alt bekannt ist. Von da an erschienen Schlag auf Schlag weitere namhafte Spielkonsolen und Handhelds.
Im Jahr 2006 veröffentlichte Nintendo die letzte Spielkonsole, die ein echter Paukenschlag war: die Wii. Sie punktete mit einem revolutionär neuartigem Spielkonzept, weil die Games über eine Gestensteuerung bedient wurden. Das verstand jedermann, weswegen die Wii nicht nur in den Wohnzimmern, sondern auch in Altenheimen zum Zeitvertreib anzufinden war. Über 100 Millionen Mal verkaufte sich die Konsole.
Die Wii ist ein Meilenstein, den „Big N“, wie Nintendo gerne genannt wird, nicht wiederholen konnte. Der Nachfolger Wii U, welcher 2012 kam, verkauft sich schleppend. Der japanische Konzern ist seitdem unter Druck, hält aber weiterhin an seinem Produkt fest. Die Konsole wird weiterhin angeboten und der ominöse Nachfolger „Nintendo NX“ soll wohl 2017 erscheinen. Dass diese Plattform aber wieder ein Erfolg wird, davon gehen Analytiker und Fans aus. Denn es gibt einen alten Spruch, der sinnbildlich für die bewegte Vergangenheit der traditionsreichen Firmen steht: „Never underestimate Nintendo!“
Doo wird zu Scanbot: Reduce to the Max
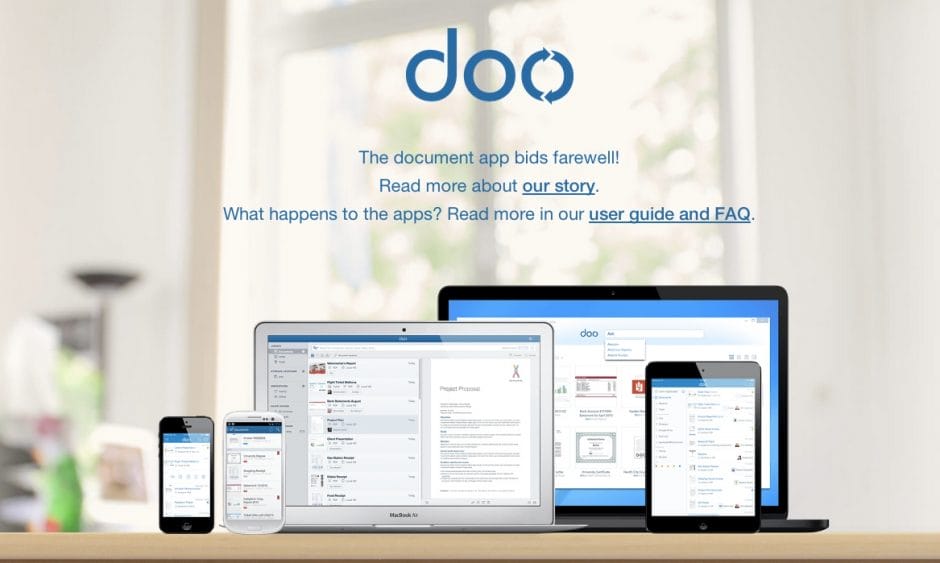
Viele kreative Köpfe haben fantastische Ideen und revolutionäre Visionen. Mit großen Schritten wollen sie am besten gleich die ganze Welt verändern. Deswegen passiert es gerne, dass ihre Konzepte und Produkte an der „Featuritis“ leiden. Nichts minder als die eierlegende Wollmilch-Sau ist das Ziel. Hierbei verstrickt man sich gerne, verliert den Fokus – und am Ende steht man vor einem Trümmerhaufen. So wie das deutsche Startup Doo.
Doo wurde 2011 vom weiter oben bereits zitierten Frank Thelen mitgegründet, der heute aus der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ bekannt ist. Das Ziel war die ultimative Dokumenten-App, um den Traum vom papierlosen Büro zu realisieren. Alleine in den ersten zwei Jahren wurden 10 Millionen Euro in das Unternehmen investiert. Doch die Erfolgsgeschichte blieb aus. Im Februar 2014 zogen die Gründer die Notbremse und kündigten einen Neustart an. Dieser wurde mit motivierenden Bildern und Sprüchen verkündet. „Farewell Doo – the document app. The team hits Restart“ oder „Every ending holds a new beginning“ war unter anderem auf der Webseite zu lesen.
Anstatt Doo neues Leben einzuhauchen, wählte Frank Thelen den Weg des Pivots. Er schmiss fast alles über Bord, was die App ausmachte, und konzentrierte sich auf ein Kernfeature: das Einscannen von Dokumenten. Das Ergebnis nannte er ganz passend Scanbot. Damit kam der erhoffte Erfolg. Bereits Ende 2015 teilte Thelen auf Facebook mit, dass man profitabel sei und über 3,5 Millionen Nutzer habe. Parallel zu der positiven Meldung zog er sich aus der Geschäftsführung zurück, um sich auf neue Projekte zu konzentrieren. Der Seriengründer hatte sein Ziel erreicht, nun galt es, neue Wege zu beschreiten.
6Wunderkinder: Mega-Exit dank Microsoft

Ein weiteres Unternehmen, in dem Frank Thelen seine Finger drin hatte, ist 6Wunderkinder. Hier stieg er als Investor ein und unterstützte das 2010 gegründete Berliner Startup mit seinem Wissen. Das erste Produkt nannte sich Wunderkit, das ganz prägnant als „Facebook für Produktivität“ angepriesen wurde. Trotz großer medialer Aufmerksamkeit und hunderttausender Nutzer entpuppte sich Wunderkit aber nicht als Wunder, sondern eher als Monster der Komplexität. Der Erfolg blieb aus.
Deswegen entschlossen sich die 6Wunderkinder eine Vollbremsung hinzulegen und mitten auf der Autobahn die Richtung zu ändern. Die neue Destination hieß nicht mehr Wunderkit, sondern Wunderlist. Diese Task-Management-Sofware war deutlich schlanker und einfacher zu bedienen. Das sorgte für viele Nutzer und ein Happy End: Im Juni 2015 wurde Wunderlist inklusive der Firma 6Wunderkinder an Microsoft verkauft. Dafür blätterte der Konzern aus Redmond zwischen 100 und 200 Millionen US-Dollar hin. Interessant ist bei alldem: Wunderlist war ursprünglich nur eine erste Fingerübung für die Entwickler gewesen. Es sollte zudem Investoren zeigen, was das Team konnte. Am Ende wurde es zum Hauptprodukt und international beachteten Erfolg.
Wer mehr darüber lesen möchte: Frank Thelen hat die ganze Story aus seiner Sicht auf Medium niedergeschrieben.
Stuffle: Gemeinsam statt einsam
Wie man an Scanbot und Wunderlist sieht: Es kann Sinn ergeben, sich auf nur eine Sache zu konzentrieren. Doch das ist deshalb kein Garant für den Erfolg. Das zeigt zum Beispiel Stuffle: Das 2012 gegründete Unternehmen aus Hamburg launchte die gleichnamige Flohmarkt-App und trat somit in Konkurrenz zu eBay. Zudem gibt es noch einen bekannten Mitbewerber aus Österreich: Shpock.
Im Frühjahr 2016 kündigte das norddeutsche Startup einen Strategiewechsel an. Aus der virtuellen Wühlkiste wurde eine Produktsuchmaschine für Kleinanzeigen. Die Kleinanzeigen stammen aus verschiedenen Stellen, die Stuffle aggregiert. Dazu gehören beispielsweise Quoka, Immobilienscout24, Autoscout24, reBuy und Bikesale.
Kooperation statt Konfrontation lautet die neue Devise. Ein Pivot, der zum Erfolg führt? Das muss Stuffle noch zeigen.
Von Odeo zu Twitter: Zwitschern statt Podcasten

Neues Konzept, neuer Versuch – so kann das Credo bei einem Pivot lauten. Dass hierbei auch der Name geändert wird, kommt vor. Das ist dann die signifikanteste Art des Reboots. Im Fall von Scanbot hat das sicherlich zum Erfolg beigetragen. Und bei Odeo spielte das auch eine Rolle.
Odeo? Dieser Name dürfte vielen unbekannt sein, dabei legte das Unternehmen die Basis für ein bekanntes Social Network: Twitter. Bis es dazu kam, war Odeo eine Plattform für Podcasts. 2005 klang das nach einer verheißungsvollen Idee. Doch dann erschien iTunes von Apple und auf einen Schlag konnten hunderte Millionen iPod-Besitzer darüber Podcasts ganz einfach abrufen. Die Zukunft von Odeo sah düster aus. Ein Richtungswechsel musste dringend her, das war dem CEO Even Williams klar, ansonsten hätten 14 Angestellte ihren Job verloren.
Um herauszufinden, was der Pivot sein könnte, veranstaltete man Hackathons. Bei diesen entwickelten die Mitarbeiter neue Konzepte und testeten ihre Ideen aus. Ein verheißungsvoller Prototyp konnte sich durchsetzen. Auf ihm basierend startete man Anfang 2006 neu durch. Der Name: „Twttr“.
Aus Twttr wurde Twitter, der Rest ist eine typische Startup-Geschichte: Der Kurznachrichten-Dienst erlebte einen kometenhaften Aufstieg. Heute hat die Company mit dem Vogel-Icon weltweit über 1,5 Milliarden Nutzer und generiert damit rund zwei Milliarden US-Dollar an Werbeeinahmen. Der Erfolg basiert unter anderem darauf, dass kaum noch eine Firma und kaum noch ein Promi umhin kommt, regelmäßig Nachrichten mit maximal 140 Zeichen zu posten. Zu den bekanntesten Twitter-Nutzern gehören Katy Perry, Justin Bieber, Taylor Swift und Barack Obama. Dabei steht Twitter allerdings stets im Schatten des übermächtigen Facebook. Zuletzt blieben die Nutzer- und Umsatzzahlen hinter den Erwartungen der Investoren zurück. Muss hier etwa erneut ein Pivot her?
Instagram: Fotos statt Alkohol

Neben Twitter und natürlich Facebook gibt es ein weiteres Social Network, das heutzutage fast unverzichtbar ist: Instagram. Auch hier war die Marschrichtung zunächst eine ganz andere. Welche, das hört man schon aus dem ursprünglichen Namen der App heraus: Burbn.
Ja, Burbn hatte wirklich etwas mit der Whisky-Variante Bourbon zu tun. Der Erfinder der App, Kevin Systrom, wollte damit einen Foursquare-Konkurrenten etablieren. Wie beim Vorbild konnte man auch bei Burbn in Locations einchecken und erhielt Punkte für soziale Interaktionen. Und man hatte die Möglichkeit, Fotos zu posten.
Der Erfolg von Burbn blieb aus, da die Smartphone-Anwendung zu kompliziert war. Das Team analysierte daraufhin, welche Funktionen am meisten genutzt werden. Es zeigte sich: Die User fanden zwar den Location-Check-In gut, aber noch mehr Gefallen fanden sie am Sharing der Bilder. Darauf hin folgte eine Marktanalyse und ein Pivot: Die Programmierer fügten Bildeffekte, die Filter, hinzu und warfen andere Features komplett über Bord. Fertig war eine Foto-App, die zwischen Hipstamatic und Facebook positioniert werden sollte.
Passend zum Restart erhielt die App einen neuen Namen: Instagram. Das war Ende 2010. Danach erlebte Instagram einen steilen Aufstieg. Der verlief sogar so steil, dass das kleine Unternehmen im April 2012 von Facebook gekauft wurde – für eine Milliarde US-Dollar. Zu diesem Zeitpunkt hatte es 30 Millionen Nutzer.
Der Deal sorgte für Aufsehen und Kritiker sahen schon das Ende kommen. Doch trotz aller anfänglicher Unkenrufe konnte Instagram seine Erfolgsgeschichte fortschreiben. Und das sogar mit noch größeren Schritten: Zirka ein Jahr nach der Übernahme hatte die App weltweit schon 200 Millionen User, im September 2014 erreichte man die doppelte Zahl. Und im Januar 2016 verkündete man stolz, dass die Grenze von 500 Millionen geknackt sei.
Lesetipp: „Instagram: Tipps und Tools für mehr Erfolg, mehr Follower, mehr Spaß“
Twitch: Mit Livestreams zum Erfolg
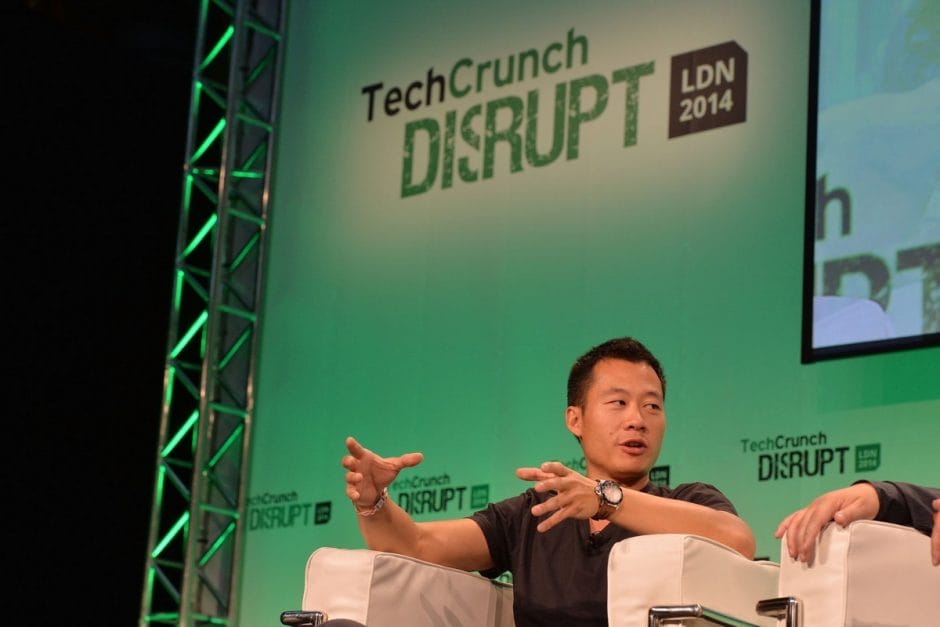
Einen Milliardendeal hat auch Justin.tv hinter sich. Besser gesagt: Twitch. Dessen Ursprünge liegen – wie so oft – in San Francisco, wo es 2007 als Justin.tv Inc. gegründet wurde. Der Erfinder ist Justin Kan, der die damals die verrückt klingende Idee hatte, sich 24 Stunden am Tag im Internet zu zeigen. Das sorgte für Aufmerksamkeit, aber nicht für Einnahmen.
Justin.tv entwickelte sich deshalb weiter und bot mehrere Kanäle zu verschiedenen Themen an. Jeder sollte nun Livestreamen können. Aber auch hier ließ der große Durchbruch noch immer auf sich warten. Es gab Einnahmen, aber das Wachstum blieb bescheiden. Besonders gut lief allerdings der Gaming-Channel. Dieser wurde schließlich 2011 ausgegliedert und Twitch.tv genannt. Ein kluger Schachzug, denn Twitch schuf eine neue Präsentationsform, die es so bislang nicht gab: Live-Gaming.
Das kam so gut an, dass Twitch den „Webby Award“ gewann und 2013 monatlich mehr als 45 Millionen Zuschauer anlockte. Die Justin.tv Inc. fokussierte sich fortan nur noch auf die Gamer bzw. Twitch und stellte deswegen im August die Webseite justin.tv ein. Im gleichen Monat erfolgte die Übernahme durch einen neuen Eigner: Amazon. Der Web-Gigant kaufte Twitch für 970 Millionen US-Dollar.
Slack: Aus einem unfertigen Spiel wurde ein Big Business
Bleiben wir in der Reihe der Milliardäre. Hier darf Slack definitiv nicht vergessen werden. Dessen Bewertung wurde im April 2016 auf 3,8 Milliarden Dollar angehoben. Noch beachtlicher erscheint die Summe, die Microsoft Anfang des Jahres dafür geboten hatte, aber dann doch nicht auf den Tisch legte: acht Milliarden. Und das, obwohl Slack erst 2013 erschienen ist.
Nicht nur der extrem hohe Marktwert und der wahrlich raketenhafte Aufstieg dorthin sind bemerkenswert, sondern auch, wie Slack entstand. Es war ein Nebenprodukt, das CEO Stewart Butterfield zur besseren Kommunikation mit externen Programmieren entwickelte. Hierüber stimmte man sich ab, um das eigentliche Projekt voran zu bringen. Das sollte ein MMO werden, also ein Massive Multiplayer Online Game. Doch dieses wurde nie veröffentlicht.

Da Butterfield und sein Team damit scheiterten, konzentrierten sie sich auf Slack. Das bekam einen massiven Zuspruch durch Millionen von Nutzern. Und das, obwohl man anfangs gar kein Marketing betrieb, sondern der Erfolg nur auf Mundpropaganda basierte.
Slack ist nebenbei bemerkt nicht der erste Erfolg von Stewart Butterfield, der eher aus Versehen aus einem Pivot entstand. Sein erstes Beispiel ist Flickr. Auch hier war das Hauptprodukt ein Gaming-Projekt, das nicht vorankam. Flickr wurde schließlich erfolgreich an Yahoo verkauft.
Neben Flickr und Slack gab es im Leben des Entrepreneurs noch weitere Produkte an denen er gearbeitet hat und letztlich scheiterte. Er ist also nicht nur ein Seriengründer, sondern auch ein Serienscheiterer – wenn man das so negativ ausdrücken mag. Trotzdem steckte Butterfield nie den Sand in den Kopf. Und hatte damit am Ende gigantischen Erfolg – zweimal.
Lesetipp: „Slack: Was dieses Werkzeug für Teams so erfolgreich macht“
Fazit
Die Konzentration auf nur eine Zielgruppe, nur ein Produkt, nur eine Richtung – das macht viele Business Pivots aus, wie es unsere Beispiele zeigen. Bevor man sich zum Kurswechsel entscheidet, können valide Daten und sauber recherchierte Annahmen helfen. Aber wie so oft im Leben spielt auch eine ordentliche Portion Glück mit.
Was aber alle Entrepreneure, die mit ihren Unternehmen einen oder mehrere Wandel durchlebten, ausmacht, ist der Wille zum Weitermachen. Mal aus Verzweiflung, mal aus reifer Überlegung heraus. Und dann heißt es, seinen neuen Kurs weiter hartnäckig zu verfolgen. Nur nicht unterbuttern lassen. Niemals aufgeben.
„Es gibt keine Alternative zum Weitermachen“, sagte Flickr- und Slack-Erfinder Stewart Butterfield in einem Interview. Nach vielen Hochs und Tiefs weiß sein Bankkonto nun, dass er damit wahrlich recht hatte.
Dieser Artikel gehört zu: UPLOAD Magazin 38
In dieser Ausgabe dreht sich alles darum, wie man einen eleganten Neustart hinlegt (oder vielleicht sogar ganz verhindern kann) – ob nun als Unternehmen oder als Privatperson oder für eine Website.
- Weitere Artikel aus dieser Ausgabe kostenlos auf der Website lesen ...
- Bleib auf dem Laufenden über neue Inhalte mit dem „Update am Montag“ …
Schon gewusst? Mit einem Zugang zu UPLOAD Magazin Plus oder zur Content Academy lädst du Ausgaben als PDF und E-Book herunter und hast viele weitere Vorteile!
Der studierte Film- und Mediendesigner ist bereits seit rund 20 Jahren in der IT- und Medienbranche tätig. Jürgen unterstützt mit seiner Marketing-Agentur JK Media Consulting Startups und mittelständische Unternehmen. Nebenher arbeitet er als freier Journalist für zahlreiche Technik- und Business-Magazine, veröffentlicht als Self-Publisher eBooks und kommt gelegentlich als Gast-Dozent zum Einsatz.


A N Z E I G E
2 Gedanken zu „Business Pivot: Wie sich Unternehmen immer wieder neu erfinden“
Kommentare sind geschlossen.